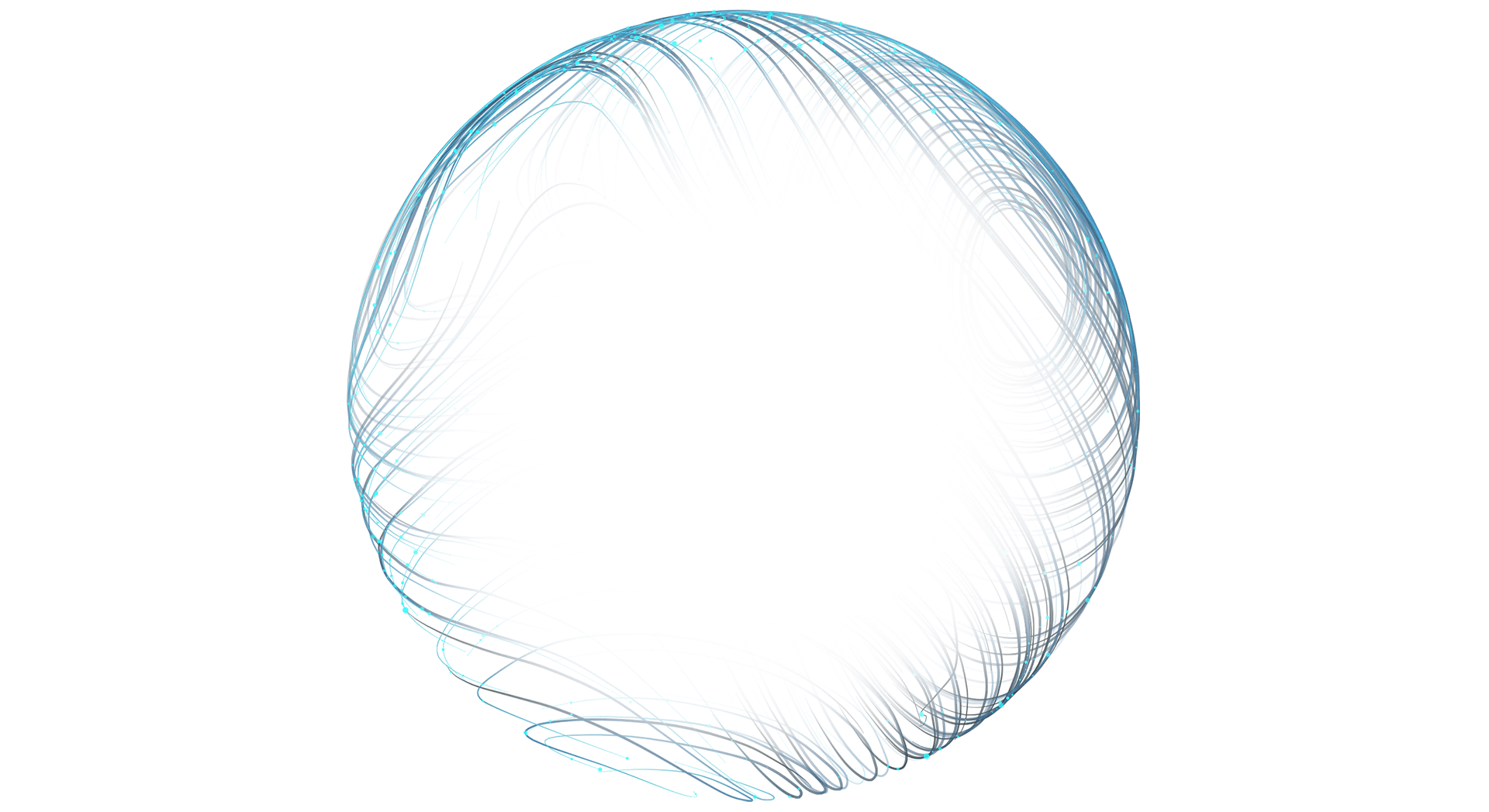
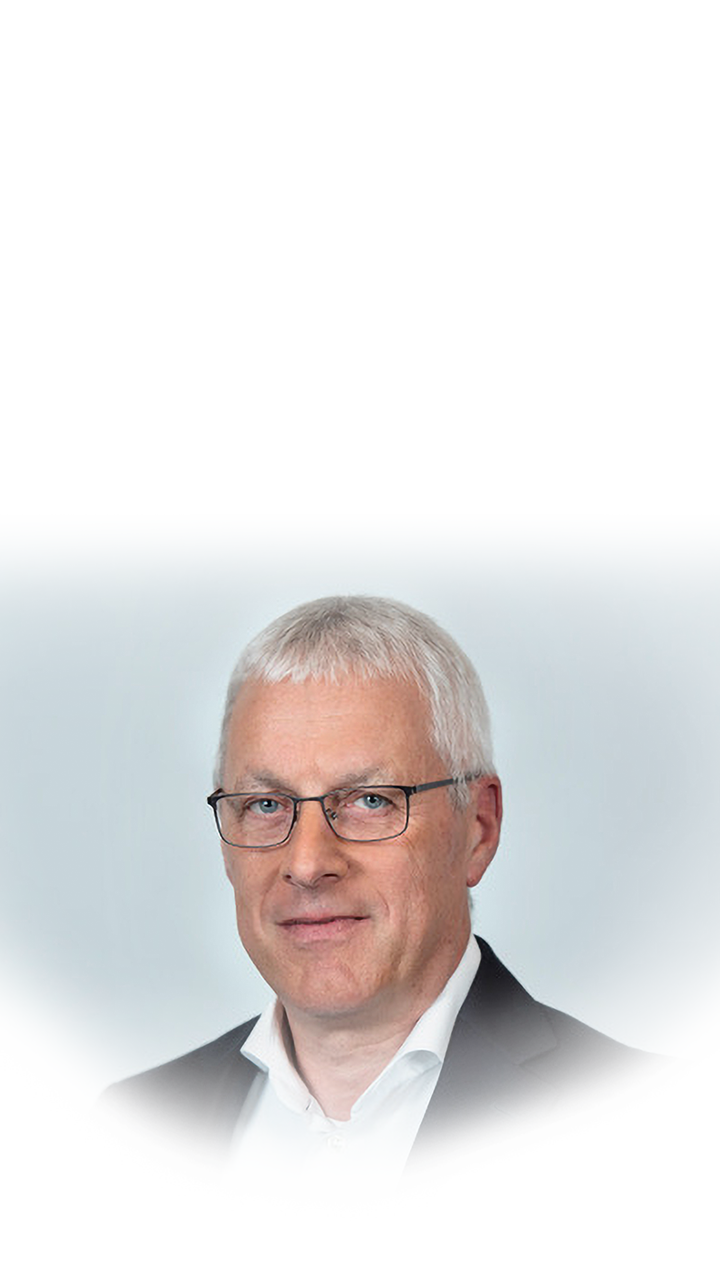


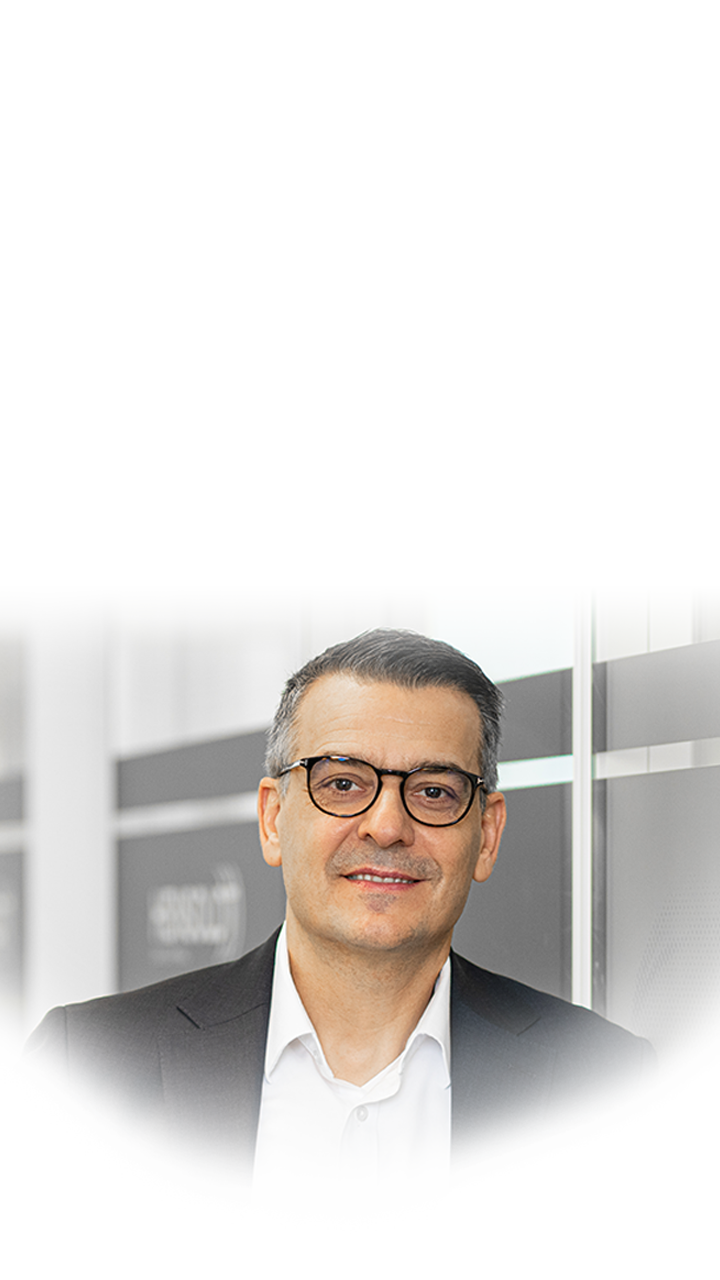
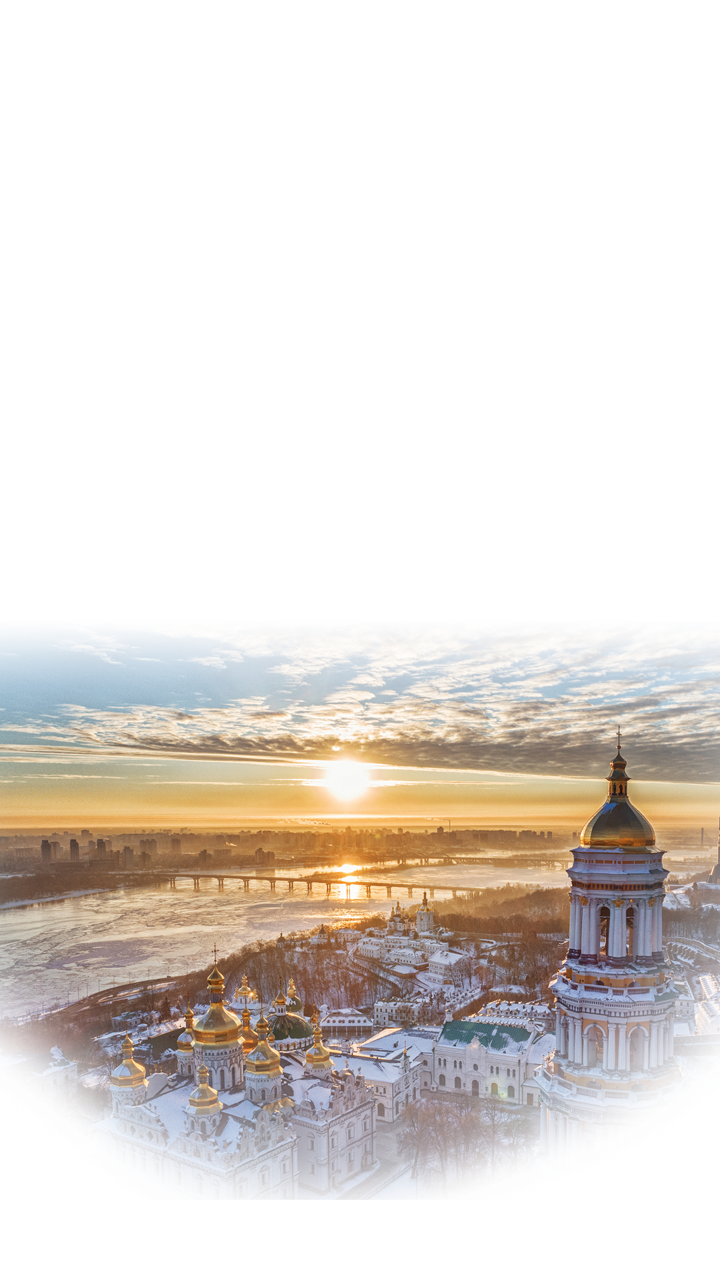

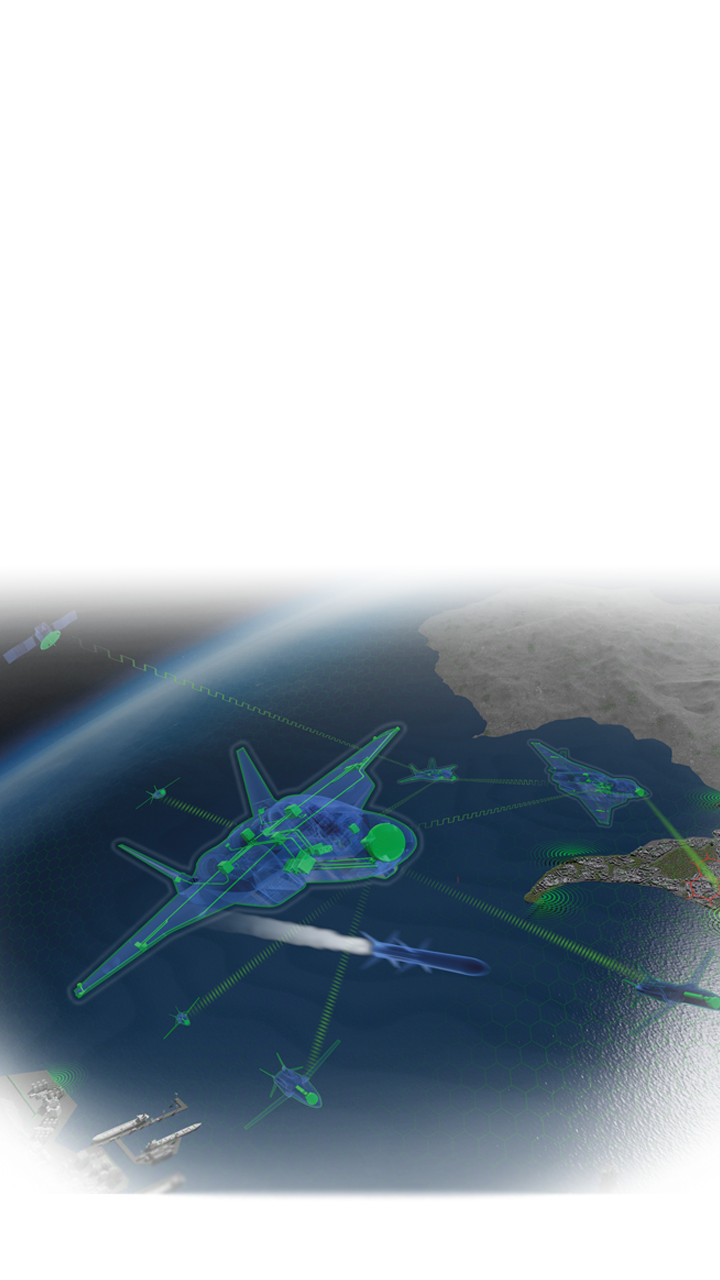



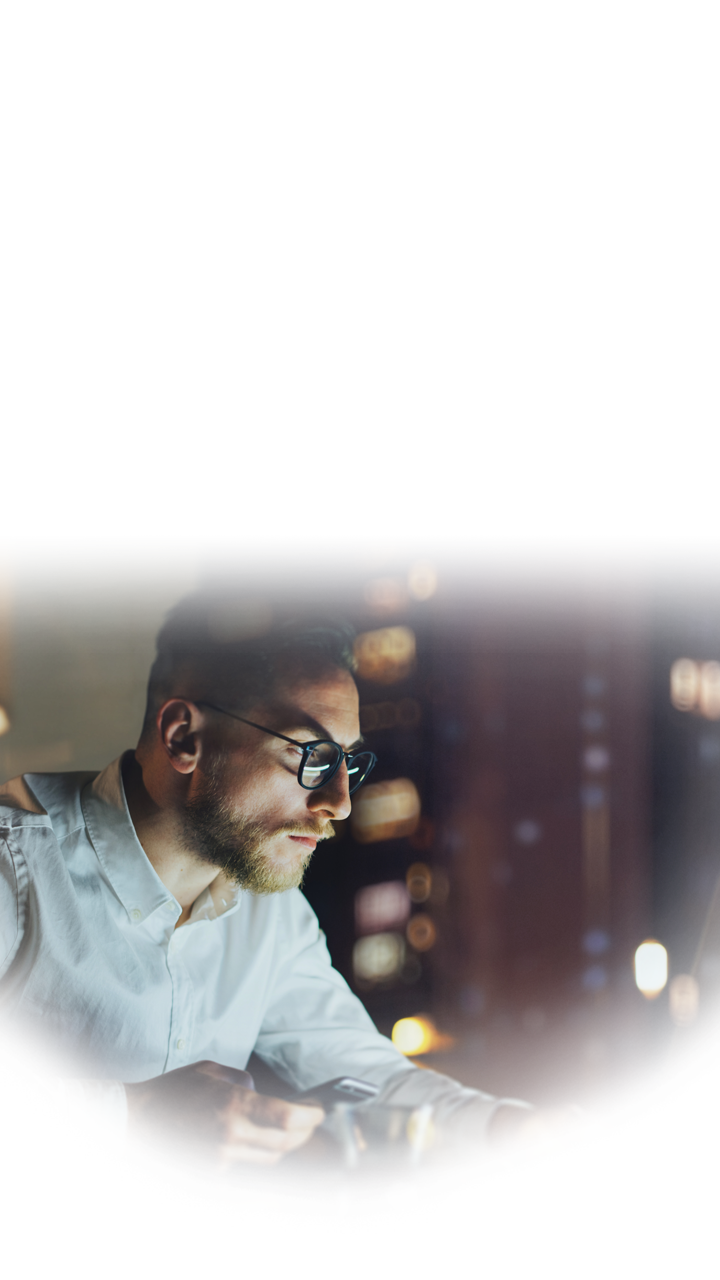
CEO Thomas Müller zum Geschäftsjahr 2023 Globale Wachstumsstrategie
Wie HENSOLDT erfolgreich neue Märkte erobert Der neue CEO stellt sich vor
HENSOLDT heißt Oliver Dörre willkommen Radare im Einsatz
Wie HENSOLDT-Technologie in der Ukraine Leben rettet Wachsendes Portfolio
Wie HENSOLDT heute die Produkte von morgen entwickelt Innovation und Technologie
Wie HENSOLDT Startup-Dynamik in die Verteidigungsbranche bringt Erfolgreiche Akquisition
Wie HENSOLDT seine Position als führender Lösungsanbieter stärkt Industrialisierte Manufaktur
Wie HENSOLDT effiziente Prozesse für seine wachsende Produktion schafft Neues Selbstverständnis
Wie die Zeitenwende die Wahrnehmung von HENSOLDT verändert hat Ingenieure der Zukunft
Wie HENSOLDT erfolgreich dem Fachkräftemangel begegnet
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Lagebericht und
Konzernabschluss 2023
HENSOLDT verbindet hohe Innovationskraft mit einem attraktiven, robusten Geschäftsmodell. 2023 waren die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt von starker Inflationsdynamik, makroökonomischer Volatilität und Verwerfungen in den globalen Lieferketten. In diesem herausfordernden Umfeld hat HENSOLDT seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. Das Unternehmen verzeichnete deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum bei hoher Profitabilität.

ESG-Bericht
2023
Nachhaltigkeit ist für HENSOLDT nicht nur eine Strategie, sondern insbesondere eine Haltung und Denkweise. Ob bei unseren Produkten, Standorten oder Lieferketten, wie nehmen unsere soziale, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung ernst. Sicherheit ist die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft und Sicherheit ist der Kern unserer täglichen Arbeit.
Der Nachhaltigkeitsbericht berichtet über Fortschritte und Entwicklungen der ESG-Strategie 2026 und erfasst Nachhaltigkeitsinitiativen sämtlicher Geschäftsbereiche.























